 Bild 1 von 9
Bild 1 von 9

 Bild 2 von 9
Bild 2 von 9

 Bild 3 von 9
Bild 3 von 9

 Bild 4 von 9
Bild 4 von 9

 Bild 5 von 9
Bild 5 von 9

 Bild 6 von 9
Bild 6 von 9

 Bild 7 von 9
Bild 7 von 9

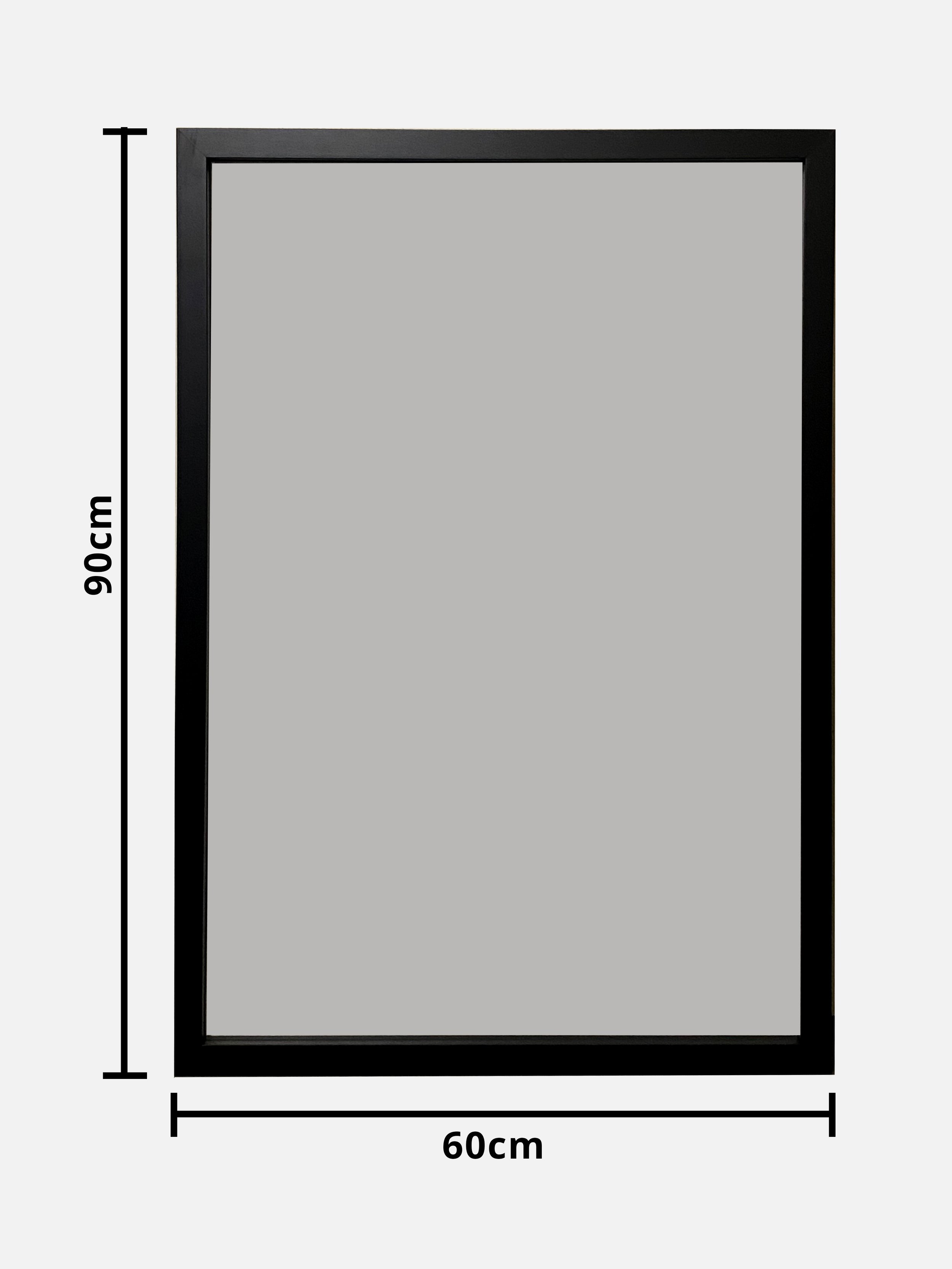 Bild 8 von 9
Bild 8 von 9
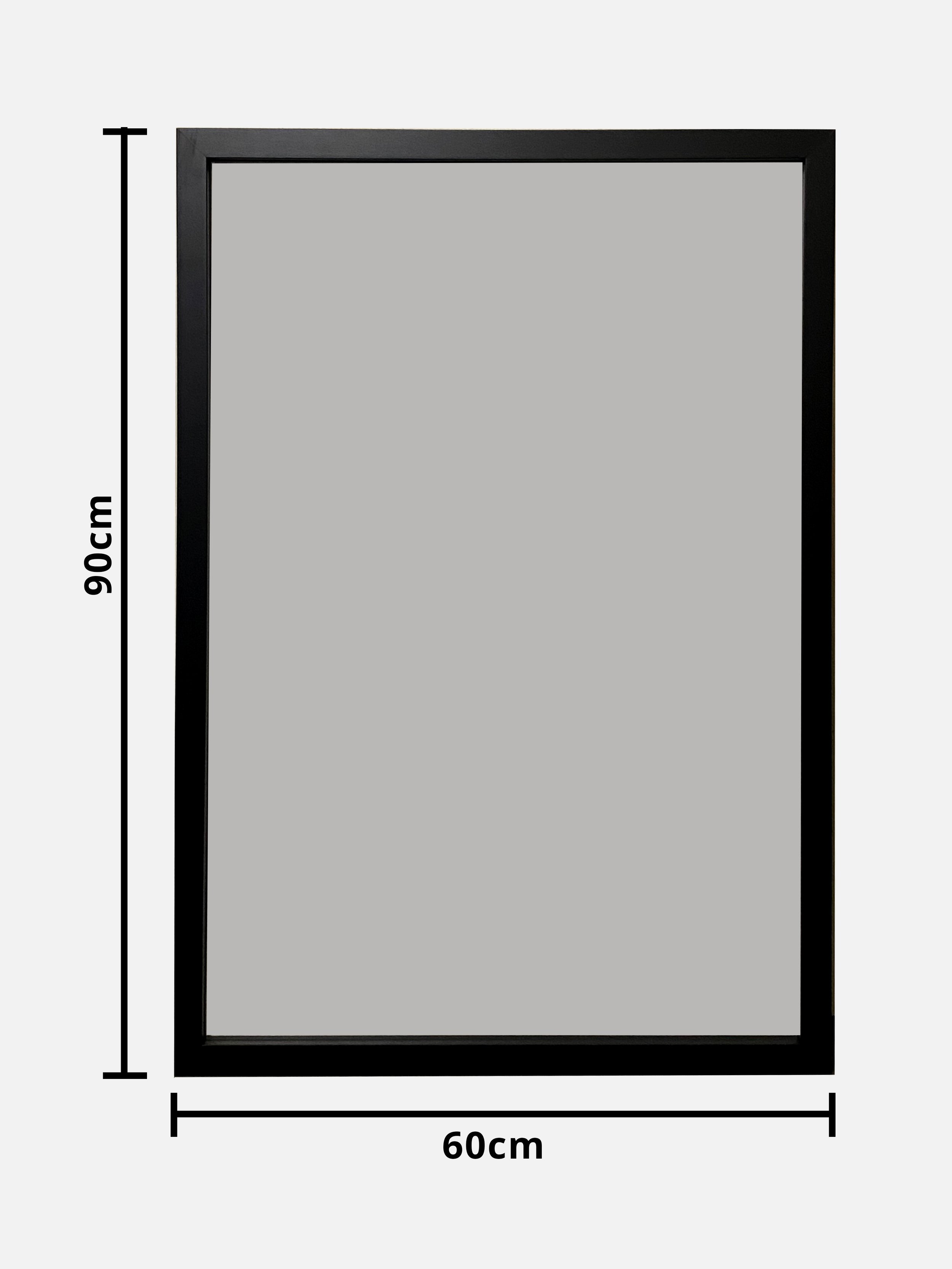
 Bild 9 von 9
Bild 9 von 9








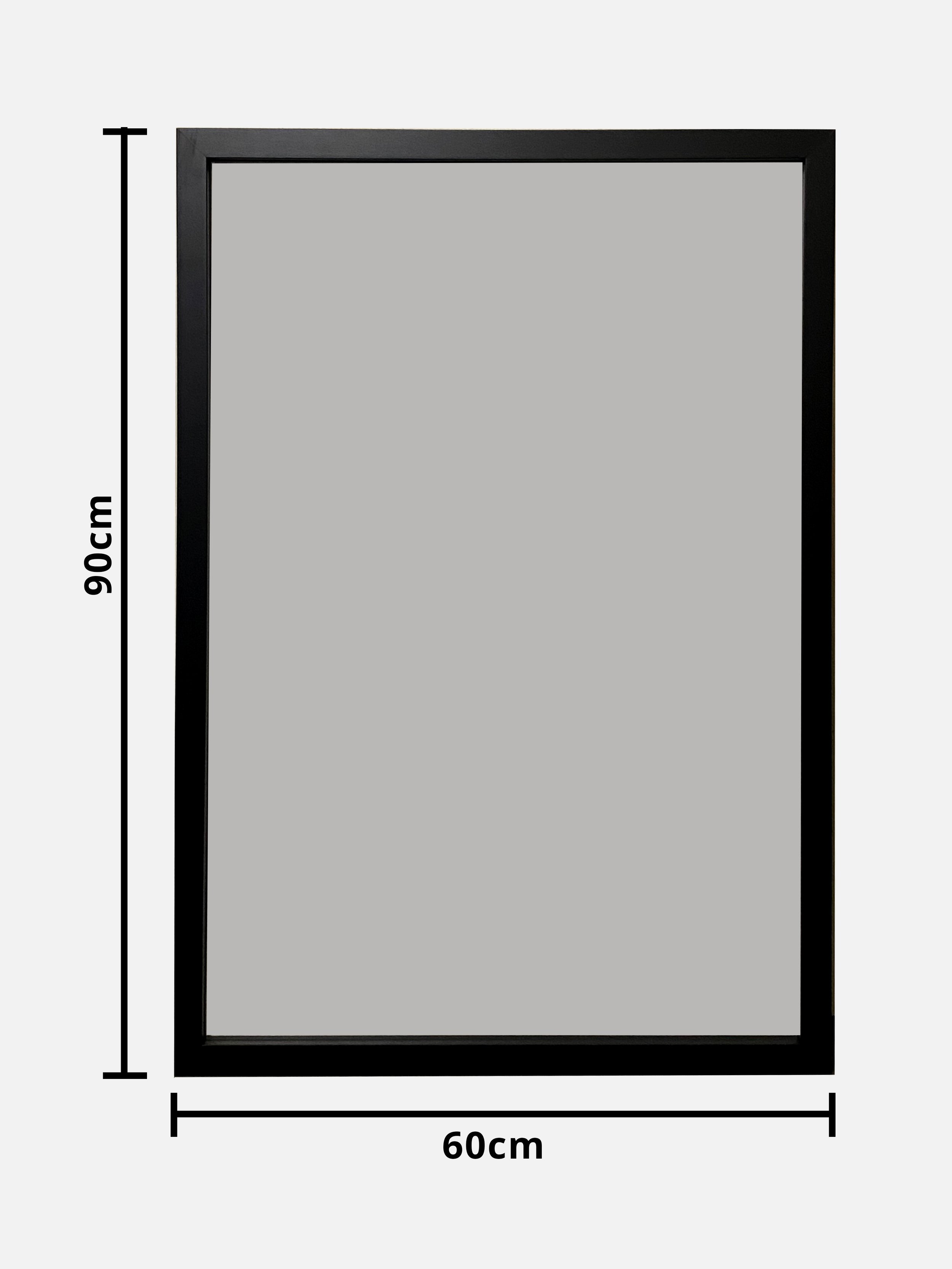

Subtile Anarchie
2025
Subtile Anarchie
Fotografie
60 × 90 cm, mit Rahmen
Das Bild der weissen Plastikskulptur eines männlichen Torsos, das auf einem leuchtend roten Podest präsentiert wird, zeigt mehrere tiefgründige Widersprüche, die sowohl in der Psychologie als auch in der Philosophie bedeutend sind.
Zunächst ist da der Widerspruch zwischen der Darstellung von Stärke und Zerbrechlichkeit. Der muskulöse Torso verkörpert traditionelle Ideale von Männlichkeit und physischer Kraft. Diese Form ruft jedoch auch ein Gefühl von Unvollständigkeit und Fragilität hervor – das Wesen des menschlichen Körpers, das jenseits seiner physischen Erscheinung existiert. Hier entsteht eine diskursive Spannung: Die Macht, die der Körper signalisiert, ist an einen starren, statischen Moment gefesselt, während das Leben selbst dynamisch und oft unberechenbar ist. Diese Diskrepanz kann dichotomische Psychologie wie die von Carl Jung hervorrufen, die sich mit dem Schatten und den archetypischen Aspekten des menschlichen Seins beschäftigt. Der Torso mag stark erscheinen, doch er repräsentiert auch die unausgesprochene Anfälligkeit der Männlichkeit.
Ein weiterer provokativer Widerspruch liegt in der Beziehung zwischen der Schönheit des Kunstwerks und der Aufforderung, nicht zu berühren. Die Skulptur, auf einem eindrucksvollen und auffälligen Sockel, zieht den Betrachter an, während das handgeschriebene «DON'T TOUCH» eine klare Grenze zieht. Diese Phase des Begehrens konfrontiert eine zentrale philosophische Idee, die von Søren Kierkegaard und dem Konzept des Erlebens des „Anderen“ geprägt ist. Der Widerspruch hier ist, dass die Kunst sowohl den Wunsch nach Nähe als auch die Ausgrenzung hervorruft – eine Erfahrung, die im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen oft als unerreichbar oder schmerzlich empfunden wird. Der Betrachter ist eingeladen, eine Verbindung zur Skulptur herzustellen, gleichzeitig wird ihm jedoch ein fundamental menschliches Bedürfnis nach Berührung und Verbindung verwehrt.
Des Weiteren wird durch den starken Kontrast zwischen der weissen Skulptur und dem roten Sockel – eingekapselt in einen schwarzen Hintergrund – eine Spannung zwischen Harmonie und Disharmonie erzeugt. Hier wird der Kunde mit der Frage konfrontiert, ob das Wesen der Kunst nicht vielmehr in der Diskrepanz zwischen Form und Farbe, zwischen Inhalt und Kontext liege. Diese dualen Kräfte können als Metapher für menschliche Emotionen interpretiert werden, die oft im Widerspruch zueinander stehen. Eine philosophische Betrachtung könnte sich auf die Anschauung von Friedrich Nietzsche stützen, der den Wert und die Natur der Wahrnehmung des Schönen und des Hässlichen in Betracht zieht und damit das Spannungsverhältnis zwischen dem Positiven und dem Negativen im menschlichen Erlebnis beleuchtet.
Insgesamt zeigt das Bild eine Vielzahl von psychologischen und philosophischen Widersprüchen, die nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern auch tiefere Fragen zur menschlichen Existenz und dem Wesen des Kunstwerks aufwerfen.
2025
Subtile Anarchie
Fotografie
60 × 90 cm, mit Rahmen
Das Bild der weissen Plastikskulptur eines männlichen Torsos, das auf einem leuchtend roten Podest präsentiert wird, zeigt mehrere tiefgründige Widersprüche, die sowohl in der Psychologie als auch in der Philosophie bedeutend sind.
Zunächst ist da der Widerspruch zwischen der Darstellung von Stärke und Zerbrechlichkeit. Der muskulöse Torso verkörpert traditionelle Ideale von Männlichkeit und physischer Kraft. Diese Form ruft jedoch auch ein Gefühl von Unvollständigkeit und Fragilität hervor – das Wesen des menschlichen Körpers, das jenseits seiner physischen Erscheinung existiert. Hier entsteht eine diskursive Spannung: Die Macht, die der Körper signalisiert, ist an einen starren, statischen Moment gefesselt, während das Leben selbst dynamisch und oft unberechenbar ist. Diese Diskrepanz kann dichotomische Psychologie wie die von Carl Jung hervorrufen, die sich mit dem Schatten und den archetypischen Aspekten des menschlichen Seins beschäftigt. Der Torso mag stark erscheinen, doch er repräsentiert auch die unausgesprochene Anfälligkeit der Männlichkeit.
Ein weiterer provokativer Widerspruch liegt in der Beziehung zwischen der Schönheit des Kunstwerks und der Aufforderung, nicht zu berühren. Die Skulptur, auf einem eindrucksvollen und auffälligen Sockel, zieht den Betrachter an, während das handgeschriebene «DON'T TOUCH» eine klare Grenze zieht. Diese Phase des Begehrens konfrontiert eine zentrale philosophische Idee, die von Søren Kierkegaard und dem Konzept des Erlebens des „Anderen“ geprägt ist. Der Widerspruch hier ist, dass die Kunst sowohl den Wunsch nach Nähe als auch die Ausgrenzung hervorruft – eine Erfahrung, die im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen oft als unerreichbar oder schmerzlich empfunden wird. Der Betrachter ist eingeladen, eine Verbindung zur Skulptur herzustellen, gleichzeitig wird ihm jedoch ein fundamental menschliches Bedürfnis nach Berührung und Verbindung verwehrt.
Des Weiteren wird durch den starken Kontrast zwischen der weissen Skulptur und dem roten Sockel – eingekapselt in einen schwarzen Hintergrund – eine Spannung zwischen Harmonie und Disharmonie erzeugt. Hier wird der Kunde mit der Frage konfrontiert, ob das Wesen der Kunst nicht vielmehr in der Diskrepanz zwischen Form und Farbe, zwischen Inhalt und Kontext liege. Diese dualen Kräfte können als Metapher für menschliche Emotionen interpretiert werden, die oft im Widerspruch zueinander stehen. Eine philosophische Betrachtung könnte sich auf die Anschauung von Friedrich Nietzsche stützen, der den Wert und die Natur der Wahrnehmung des Schönen und des Hässlichen in Betracht zieht und damit das Spannungsverhältnis zwischen dem Positiven und dem Negativen im menschlichen Erlebnis beleuchtet.
Insgesamt zeigt das Bild eine Vielzahl von psychologischen und philosophischen Widersprüchen, die nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern auch tiefere Fragen zur menschlichen Existenz und dem Wesen des Kunstwerks aufwerfen.
